HZ 20. Dezember 2022
nicht von den Altstadtfreunden Hersbruck, aber dennoch auf der Homepage, weil dies die Altstadt betrifft!
Stadtentwicklung Hersbruck hat sich im Blick auf die Geschäfte gewandelt. Doch warum?
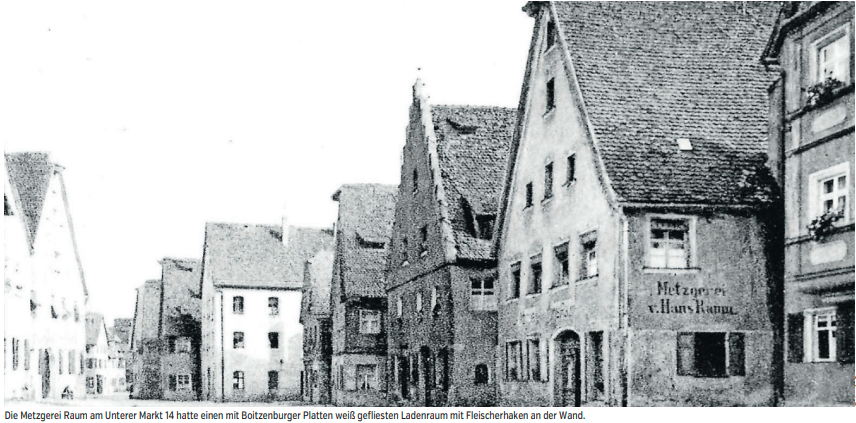
Stadtentwicklung Hersbruck hat sich im Blick auf die Geschäfte gewandelt. Doch warum?
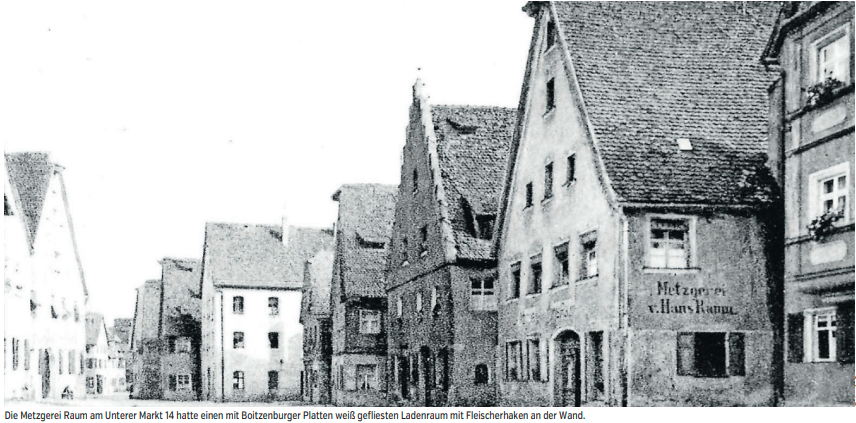
HERSBRUCK – „Als ich 1975 meine
Lehre begann bei Auto Dannhäuser,
gab es in Hersbruck noch viele Autohändler“, erinnert sich Erwin Müller
aus Thalheim, „als Vertragshändler
ist nur Auto Dannhäuser übriggeblieben“. Und das ist nicht sein einziges
Beispiel für sichtbare städtische Veränderungen.
Der 62-Jährige zählt auf, dass man
in Hersbruck damals jedes Fabrikat
habe kaufen können: „Mercedes
beim Scharrer, Simca bei Dannhäuser, Opel bei Kropf, Ford bei Schweininger - später Lotter -, Honda beim
Zirzawa, BMW beim Wagner, Fiat
beim Lutz, VW Audi bei Wolf, Peugeot bei Amann und Renault beim
Koch.“ Und auch bei den Metzgern
und Bäckern habe es viel mehr Auswahl gegeben.
„Wir waren eine ganze Klasse in
der Berufsschule nur mit Lehrlingen
aus Hersbruck. Damals war es üblich, dass die Stiften für die ganze Belegschaft zum Brotzeitholen gingen.“
Für Müller hieß das: Erst zum Bäcker
Neidinger - jetzt Hollederer -, dann
zum Metzger Müller hinter der SchellTankstelle und schließlich zum
VEGE Pillhofer. Wenn er heute nachrechnet, gab es seinerzeit sieben
Bäcker: Neidinger, Hirnigel in der
Nürnberger Straße, Distler am Spitaltor, Wendler am Unteren Markt,
Erbar (später Trunk) in der Martin Luther-Straße, Angermann in der
Schulgasse und der Buberl.
Müllers Bilanz heute: Bäcker aus
Förrenbach, Thalheim und Pommelsbrunn mit Filialen in Hersbruck.
Das
gleiche Bild macht er bei den Metzgern aus: Mit Mertel, Schramm und
Gösswein auf der Ostbahn, Kratzer,
Ehrensberger, Schwab, Schönert,
Müller und Hartmann kommt er auf
neun Läden. Nur Letzterer sei noch
in Betrieb. Doch warum ist das so? „Zu mir
sagte mal ein Metzger, als ich fragte,
warum er aufhört: Nur der Wandel
ist beständig.“ Und damit hat der
Befragte recht, bestätigt Monica
Rüthers in einem Beitrag über Stadtentwicklung für die Bundeszentrale
für politische Bildung: „Städte sind
soziale Organismen, die sich laufend verändern.“ Grund seien „Eingriffe
wechselnder Leitbilder oder Modernisierungsschübe“, hat die Professorin
für Osteuropäische Geschichte an
der Universität Hamburg analysiert.
Dass es in Hersbruck in den
1970ern so viele Geschäfte gab, ordnet sie unter anderem den westdeutschen Wirtschaftswunderjahren zu.
Außerdem wurde Deutschland nach
dem Zweiten Weltkrieg „bewusst
dezentral wiederaufgebaut“. Für die
großen Metropolen bedeutete dies,
dass sich in Bonn die Regierungsbehörden und die Lobby, in Hamburg
und Düsseldorf der Handel, in Köln
und München Versicherungen, in
München Publizistik und Kultur und
in Frankfurt die Finanzen konzentrierten, schreibt Rüthers. Und für
die kleinen Städte, dass alles Lebensnotwendige vor Ort blieb oder gar ausgebaut wurde.
Daneben förderte wohl auch ein
Leitbild der 1950er und 1970er Jahre
den Aufschwung der Hersbrucker
Innenstadt, so Rüthers: die „autogerechte Stadt“. Das änderte sich aber
mit der Ölkrise 1973, weiß die Historikerin. Ein „neues ökologisches
Bewusstsein“ beeinflusste laut
Rüthers die westdeutsche Stadtentwicklungspolitik grundlegend: „Straßenprojekte wurden auf Eis gelegt
und Innenstädte vom Autoverkehr
befreit.“.
Danach setzte sukzessive auch der
Wandel in Hersbruck ein. „Die
Kehrseite der Verkehrsberuhigung
war der Bau von Einkaufscentern an
den liefertechnisch besser erreichbaren Stadträndern“, erklärt Rüthers
das, was Müller in seinen 62 Lebensjahren beobachtet hat. Damit wird
die Veränderung nicht abgeschlossen sein, ist sich die Expertin sicher.
Denn: „Heute erhalten Freizeitangebote und die Qualität öffentlicher
Räume viel Aufmerksamkeit“ - wie
beispielsweise der Obere Markt in
Form der geplanten Neugestaltung.
Öffentliche Plätze, Parks und Freizeitgelände hätten eine Umverteilungsfunktion: „Sie korrigieren soziale
Ungleichheiten. Teilhabe verbessert
die Lebensqualität.“
Andrea Pitsch