HZ vom 23.März 2020 Seite 5
Hersbrucker Altstadtfreunde besichtigen Amberger Ausstellung über Bodenschätzung
Hersbruck/Amberg - Auf Anregung von Dieter Striegler besuchte noch im Februar eine kleine Gruppe von interessierten Hersbrucker Altstadtfreunden
die Ausstellung im Staatsarchiv Amberg, die den doppeldeutigen Titel :"
Grund und Boden -hoch geschätzt " trug. Vorstand Georg Hutzler hatte
mit der Direktorin Frau Dr. Maria Rita Sagstetter einen Termin
vereinbart und die Hersbrucker hatten das Glück, von ihr direkt durch
die kleine Ausstellung mit ihren ca. 60 Exponaten geführt zu werden.
Natürlich wußten bereits die Kelten,
wo sich der Anbau lohnte und unsere Bauern kennen die Bonität ihrer
Böden sehr wohl. Ob es Sand-, Lehm-, Ton- oder Moorböden sind, erkennt
man auch als Laie. Daher hatten bereits die alten Kulturvölker im
Orient Bodenvermessung und Bodenschätzung gekannt. Auch in Deutschland
war im Mittelalter die Einteilung in sogenannte Hufe
(fränkisch Huben) bekannt. Eine Vollhufe diente dem Unterhalt einer damaligen Großfamilie. Diese waren aber unterschiedlich groß, da sie vom Personalstand des Bewirtschafters und von den natürlichen Ertragsvoraussetzungen abhingen. So spielte also eine Bodenschätzung eine wesentliche Rolle, um eine Familie ernähren zu können.
(fränkisch Huben) bekannt. Eine Vollhufe diente dem Unterhalt einer damaligen Großfamilie. Diese waren aber unterschiedlich groß, da sie vom Personalstand des Bewirtschafters und von den natürlichen Ertragsvoraussetzungen abhingen. So spielte also eine Bodenschätzung eine wesentliche Rolle, um eine Familie ernähren zu können.
Doch in den 30iger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts wurde die Bodenschätzung auf wissenschaftliche
Grundlage gestellt. Vor allem der Staat war daran interessiert, um eine
gerechte Steuer erheben zu können. Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts
war ja in Bayern die Landesvermessung durchgeführt worden, die
als Grundlage für die Grundsteuer diente. Sie war in Katasterkarten und
Meßbüchern niedergelegt. Dem Bodenschätzungsgesetz von 1934 folgte 2008
das Gesetz zur Schätzung des landwirtschaftlichen Kulturbodens. Dort
heißt es in § 1 : Zweck der Bodenschätzung ist es, für die Besteuerung
der landwirtschaftlichen nutzbaren Flächen des Bundesgebiets
einheitliche Bewertungsgrundlagen zu schaffen. Die Bodenschätzung dient
auch nichtsteuerlichen Zwecken, insbesondere der Agrarordnung, dem
Bodenschutz und Bodeninformationssystem.
Bereits im Reichsbewertungsgesetz von
1925 wurde die Ertragsfähigkeit eines Bodens mit einem Spitzenbetrieb
in der Magdeburger Börde verglichen, der die Wertezahl 100 hatte. Neben
der Bodenbestandsaufnahme wurde auch die Ertragsfähigkeit auf Grund der
natürlichen Ertragsbedingungen wie Bodenbeschaffenheit,
Geländegestaltung, klimatische Verhältnisse und Wasserverhältnisse
festgestellt.
Eine fest vorgegebene
Bewertungsgrundlage ist die geologische Entstehung der Böden. Hier wird
besonders zwischen Verwitterungs-, Diluvial-, Alluvial-und Lößböden
unterschieden. Freilich ist auch die verschiedene Korngröße von
Bedeutung, die von feinstem Ton bis zu Kies reicht. Diese wird durch
Fingerprobe und Sichtprüfung ermittelt. Die Böden werden in sieben
Zustandsstufen eingeteilt. Sie werden auch nach den Merkmalen Bodenart,
Zustandsstufe und Entstehung (Acker) bzw. Boden, Klima und Wasser
(Grünland) in Klassen eingeteilt, für die Wertzahlen festgelegt sind.
Nach der vielen Theorie waren auch
praktische Dinge zu sehen, wie Bodenproben, Messgeräte, und moderne
Computereinrichtungen. Besonders interessant waren die ausgestellten
Karten, die häufig bei Akten mit beiliegen. Die meisten waren aus der
Oberpfalz. Eine Karte jedoch aus dem Gebiet der ehemaligen Oberpfalz,
das heute zum Landkreis Nürnberger Land gehört, nämlich eine Karte aus
dem 18. Jahrhundert von Neuhaus an der Pegnitz. Sie zeigt neben den
umliegenden Mühlen Rothenbruck und Finstermühle auch die Art der
Bodennutzung in Wald, Wiese und Ackerland.
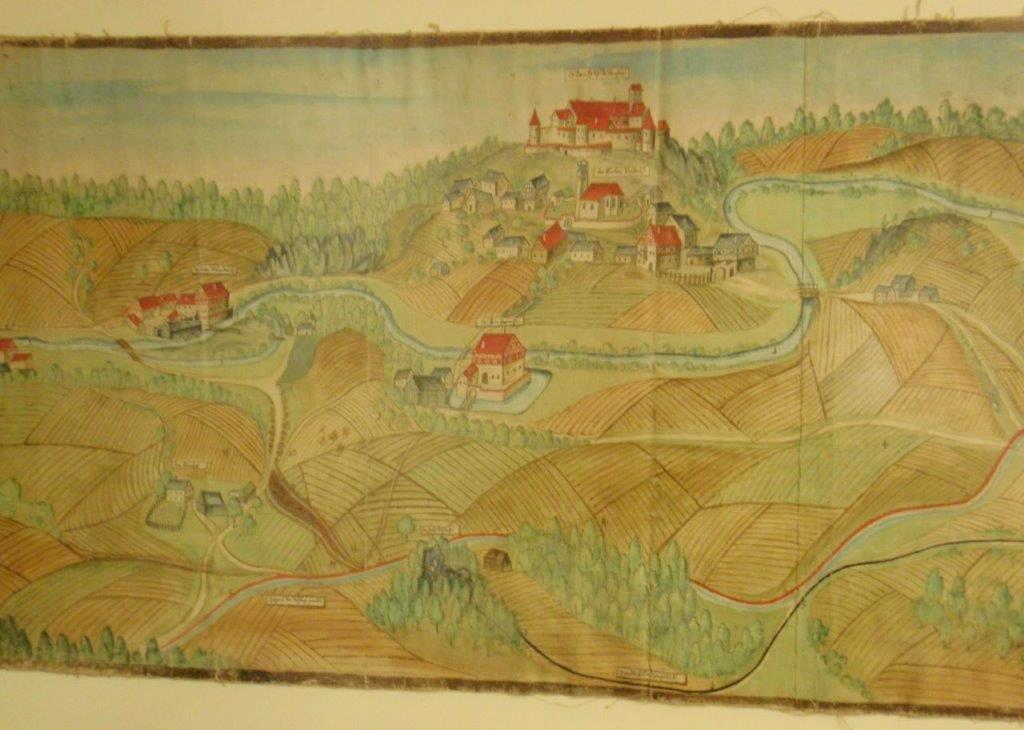
Reichenschwand, 20.3.2020 Helmut Süß